Auf jeden Fall wird man weiter verhandeln, um irgendwie dem Notstand in Griechenland Herr zu werden. Handlungs- und Reformbedarf gibt es aber für die gesamte Eurozone, nicht nur gegenüber Griechenland. Denn eine Währungsunion mit 19 verschiedenen Staatsschulden mit 19 verschiedenen Zinssätzen, auf die die Finanzmärkte ungehindert spekulieren können, kann auf Dauer nicht funktionieren. Einige Länder zahlen sehr niedrige Zinsen, andere unerträglich hohe und kommen von ihrem hohen Schuldensockel nicht mehr runter wie Italien und eben Griechenland. Die Währungsunion ist deshalb dringend zu ergänzen mit der Fiskalunion. Der erste Schritt, die Schuldenbremse, ist längst getan. Der nächste ist fällig: zentrale Bereiche der Fiskalpolitik müssen in die gemeinsame Steuerung und Verantwortung der Euroländer geführt werden.
Dies bedeutet zum einen die Vergemeinschaftung der öffentlichen Schulden, zum anderen eine gemeinsame Steuerpolitik. Mit dem Euro haben die Mitgliedsländer auf ihre Währungshoheit verzichtet. Das Gegenstück dazu fehlt aber: die Schuldengemeinschaft, damit alle Mitglieder in den Genuss stabiler und niedriger Zinsen auf die öffentlichen Schulden kommen. Hat man diesen Schritt getan, kann nicht mehr jedes Euroland allein sein jährliches Staatsdefizit festlegen, sondern darf nur mehr eine gerechte, gemeinsam ausgehandelte Quote an Eurobonds emittieren. Dafür ist ein europäischer Schuldenfonds zu errichten. Das jährliche Defizit der Mitgliedsländer und der Rhythmus des Schuldenabbaus kann dann in einem demokratischen Entscheidungsprozess entschieden werden, ohne einzelne Mitglieder in den Ruin zu treiben.
Eine Fiskalunion bedeutet aber auch, die Steuerpolitik – soweit es Sinn macht – zu vergemeinschaften. Mehrwertsteuer, Finanztransaktionssteuer, Körperschaftssteuer sowie eine spezifische EU-Abgabe wären unionsweit zu regeln, zumindest fürs Euroland. Man kann sich das für die Eurozone gut nach dem Modell der Schweiz vorstellen. In der Schweizer Finanzordnung sind die steuerpolitischen Zuständigkeiten auch auf drei Ebenen aufgeteilt: Bund, Länder und Kantone. Einkommen- und Vermögenssteuern sind kantonal, die Mehrwertsteuer bundesweit geregelt. Vernünftiger europäischer Steuerföderalismus nach bewährten Mustern ist gefragt. Vor allem die Körperschaftssteuer bedarf dringend einer Euroland-weiten Regelung, um den ruinösen Wettbewerb zwischen den Euroländern zu beenden, der von den Konzernen kräftig ausgenutzt wird.
Wer sollte über diese Fiskalpolitik entscheiden? Joschka Fischer hat den Vorschlag gemacht, eine neue Kammer zu bilden, bestehend aus den Mitgliedern der Finanz- und Sozialausschüsse der Parlamente der Euroländer. Dieses Euro-Finanzparlament hätte die demokratische Kontrolle über diesen Prozess auszuüben. „Wir müssen alles vergemeinschaften, was uns alleine nicht gelingen kann,“ schreibt Thomas Piketty in „Die Schlacht um den Euro“ (C.H. Beck, 2015). Die Staatsschulden, die Eurobonds, die Finanztransaktions- und Körperschaftssteuer, der Kampf gegen die Steueroasen und CO2-Abgaben – das sind einige der Prioritäten. Europa braucht den Euro. Die Griechenlandkrise hat die strukturellen Mängel des Euro nur noch klarer zu Tag treten lassen. Wenn der Euro Bestand haben soll, kann man nach Griechenland nicht zur Tagesordnung übergehen und die nächsten Krisen einfach abwarten.



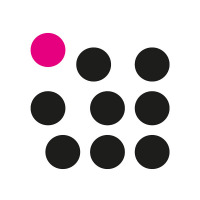
Kommentar schreiben
Zum Kommentieren bitte einloggen!Kommentare