Politisches Bewusstsein wird weiter auseinanderdividiert
Die Mitgliedschaft in einem Staat (Bürgerschaft) begründet Rechte und Pflichten. Den Südtirolern würde die zusätzliche Bürgerschaft im österreichischen Staat vor allem Rechte wie das Wahlrecht verschaffen und neue Leistungsansprüche begründen, aber weniger Pflichten bewirken: weder hätten wir Steuern nach Wien zu entrichten noch zum Bundesheer einzurücken. Weil wir bei der Nationalratswahl mitwählen könnten, würden sich die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler etwas mehr für die österreichische Politik interessieren, die uns nicht direkt betrifft; entsprechend weiter ab nähme das Interesse für die italienische Politik, die uns direkt betrifft. Laut ASTAT verfolgt schon heute nicht mal ein Zehntel dieser Kreise die italienische Politik näher (vgl. ASTAT, Lebensformen und Werthaltungen in Südtirol, Bozen 2007). Das Land fiele im politischen Bewusstsein und sprachlich getrennten Medienkonsum noch weiter auseinander.
Es gibt schon das Gleichstellungsgesetz
Ohne Zweifel könnte die doppelte Staatsbürgerschaft die Bindung der Minderheiten zum “Mutterland” einerseits und die Verantwortung der Schutzmacht für seine Staatsbürger im Ausland andererseits nochmals stärken. Doch sind die Südtiroler einerseits durch das Gleichstellungsgesetz in Österreich ohnehin schon in vielerlei Hinsicht den Inländern gleichgestellt. Andererseits ist unsere Autonomie völkerrechtlich abgesichert und die Schutzfunktion Österreichs dafür wird von Italien nicht in Frage gestellt. Die eigentliche “Schutzfunktion” hat ja die Autonomie, dies es uns ermöglicht, im eigenen Land gleichberechtigt und eigenständig zu leben. Sie hat auch den Sinn, dass alle offiziellen Sprachgruppen die Politik gleichberechtigt und möglichst eigenständig gestalten und nicht mit halben Fuß im jeweiligen “Ausland” leben. Mit der Erfüllung neuer Leistungsansprüche von nicht Steuer zahlenden Staatsbürgern im Ausland wird man sich auch in Wien schwer tun, weil man auch dort weiß, dass Südtirol kein armes Land mehr ist.
EU-Bürgerschaft wichtiger
In Südtirol würde die doppelte Staatsbürgerschaft die bestehende Ausdifferenzierung von Bürgern mit verschiedener Rechtslage erweitern: die Angehörigen der altösterreichischen Minderheiten, die “normalen” Staatsbürger, die EU-Bürger, die ausländischen Mitbürger mit Daueraufenthaltsrecht, jene mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung. Für die schon recht gut geschützten Bürger würde ein neuen Schutzschirm aufgespannt, während für die “emotionale Einbürgerung” der italienischen Mitbürger und die Integration der neuen Zuwanderer mit einer solchen Neuerung nicht geholfen wäre. Ein weiterer Schutzschirm ist auch deshalb wenig dringlich, weil Europa allgemein einen Rechtsrahmen für den Minderheitenschutz aufgebaut hat, die Rahmenkonvention für Nationale Minderheiten, die Italien und Österreich ratifiziert haben. In der EU ist man von Doppelstaatsbürgerschaften abgekommen, weil man zum einen Nicht-EU-Migranten zu einer Entscheidung bezüglich ihres Lebensmittelpunkts bewegen will, und zum andern die EU-Bürgerschaft allen EU-Bürgern ohnehin eine breite Palette von Rechten und Möglichkeiten eröffnet.
Mehr Bindung zum Land für alle
Nicht zusätzlicher Schutz durch Angehörigkeit zu einem anderen Staat ist vordringlich, sondern mehr gemeinschaftliche Bindung zum eigenen Land aller Gruppen. Gerade die alte Migration (Italiener, die vor 2-3 Generationen zugewandert sind), und die Migration der letzten 25 Jahre werfen ein Problem dieser Art von Bürgerschaft auf. Viele Italiener sind noch immer nicht ausreichend in Südtirol verwurzelt, sprechen wenig Deutsch, misstrauen der deutschen Mehrheitsbevölkerung wie die letzte Volksabstimmung deutlich gezeigt hat, klammern sich an faschistische Relikte und Ortsnamen, als ob diese Identität begründen könnte. Sie betrachten die Staatsbürgerschaft als entscheidend, nicht die Regionsbürgerschaft. Für die neuen Einwanderer ist der Weg zur Integration in ein Land wie unseres anstrengend: der italienische Staat erschwert die Einbürgerung und in Südtirol müssen sie und ihre Kinder gleich zwei neue Sprachen lernen. Dabei wirft schon eine fremde Sprache ein Problem auf: die vielen halbsprachigen Migrantenkinder in den Ländern mit älterer Migration, die im Bildungssystem und Arbeitsmarkt ganz unten landen, zeugen davon. Andererseits haben die Zuwanderung und die politischen Reaktionen darauf auch einen Mangel in der Autonomie aufgezeigt: Südtirol kann die Zuwanderung nicht autonom steuern.
Vorbild Åland-Inseln
Eine solche Möglichkeit hat hingegen eine andere autonome Region Europas. Auf den Åland-Inseln gibt es das Hembygdsrätt, eine Art Heimatrecht, als Rechtsinstitut. Es wird jenen finnischen Staatsbürgern zuerkannt, die ausreichend Schwedisch sprechen und eine Mindestansässigkeitsdauer vorweisen können. Dieses “Heimatrecht” eröffnet ihnen die Möglichkeit, auf Åland eine Gewerbe auszuüben, Grund zu erwerben und das passive und aktive Wahlrecht auszuüben. Eine solche Regionsbürgerschaft mag für diese fast nur schwedischsprachigen Inseln Finnlands Sinn machen, für Südtirol nicht, obwohl sie absolut EU-konform ist. Doch der Grundgedanke ist wichtig: es geht darum die Bindung der Menschen zu ihrer Region und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken; darum, die Migrationsbewegungen zu stabilisieren und bessere Bedingungen für die Integration zu schaffen; darum, gemeinsame Verantwortung für die engere Heimatregion aufzubauen. Eine solche Regionsbürgerschaft kann allen offen stehen, In- und Ausländern, alten und neuen Zuwanderern. Sie knüpft an denselben Kriterien an, die für den Erwerb der Staatsbürgerschaft, aber auch für den Bezug einiger öffentlichen Leistungen in Südtirol gelten: die legale Ansässigkeitsdauer. Dazu gesellt sich der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, in diesem Land zu leben. Eine derartige Regionsbürgerschaft darf nicht bloß symbolische Wirkung, sondern muss auch konkrete Rechtswirkungen und dadurch einen praktischen Nutzen haben. Sie kann Nicht-Staatsbürgern den Zugang zu Teilbereichen des öffentlichen Dienstes, zu Sozialleistungen (Wohnbau usw.) und zum Wahlrecht auf Gemeinde- und Landesebene öffnen. Sie stabilisiert die Migration und ermutigt Zuwandererfamilien, eine langfristige Perspektive in der Region aufzubauen. Nicht die formale Staatsbürgerschaft, die später folgen kann, sondern Kriterien persönlicher Leistung (Spracherwerb und Sprachnachweis) und das objektive Kriterium der Ansässigkeitsdauer wären maßgeblich. In einem Satz: statt mit doppelter Staatsbürgerschaft noch einen weiteren Schutzschirm für schon Geschützte einzuführen, kann mit einer Regionsbürgerschaft beides befördert werden: mehr Einfluss auf die Migration durch die Landespolitik auszuüben und eine bessere Integration jener Mitbürger zu fördern, die in Südtirol den geringsten Schutz genießen.
Regionsbürgerschaft die Alternative
2016 werden an die 50.000 ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen in Südtirol leben, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und für sich und ihre Kinder eine Zukunftsperspektive aufbauen wollen. Südtirol braucht keine fluktuierende Manövriermasse von Migranten, die kommen und gehen, die keinen Bezug zu unserem Land finden, sondern Menschen, die sich in dieses Land bis zu einem bestimmten Grad “einbürgern” wollen. Somit ist, neben der Staatsbürgerschaft, eine neue Form von Regionsbürgerschaft gefragt, die allen offen steht, die hier arbeiten und auf Dauer leben wollen. Nicht unbedingt die Begründung zusätzlicher Rechte und Ansprüche im Ausland – das ist und bleibt Österreich rechtlich gesehen - schon geschützter Angehörigen einer ethnischen Minderheit ist nötig, sondern mehr Beheimatung für jene, die das Leben zur Auswanderung gezwungen hat und die in Südtirol eine zweite Heimat gefunden haben.



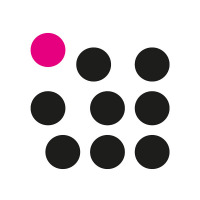
Kommentar schreiben
Zum Kommentieren bitte einloggen!Kommentare