Diesmal bei den Fragestellungen noch breiter und in der Analyse noch tiefergehend ist diese ASTAT-Publikation ein Muss für jeden, der sich mit Sprachenpolitik in unserem Land auseinandersetzt (www.provinz.bz.it/astat).
Die Zwei- und Mehrsprachigkeit ist hierzulande traditionell eines der spannendsten Themen. Der Sprachbarometer musste zunächst entscheiden, was eine Muttersprache ist. Ist es die Erstsprache, die Selbstzuordnung oder die tatsächliche Sprachkompetenz? Die Befragten konnten das selbst entscheiden, konnten demnach auch zwei oder drei Sprachen nennen. Das ASTAT-Wissenschaftlerteam (Haller, Gosetti, Lombardo, Siller) verweist aber auch auf die wissenschaftlich präzisere Lösung, die Kanada bei seiner Volkszählung anwendet. Eine Person hat demzufolge zwei Muttersprachen, wenn die beiden Sprachen gleich häufig verwendet werden und wenn die Person sie immer noch beherrscht. Es wird manche überraschen, dass nur 5,3% der Südtiroler zwei Erstsprachen angeben. Der Anteil der Personen mit zwei Erstsprachen ist unter „Italienern“ und „Deutschen“ mit 4,6% gleich hoch.
Auch die Art der Zweisprachigkeit bei Erstsprachen (Familiensprachen) streut seit Beginn der neuen Migration immer stärker. Die klassische Kombination Deutsch-Italienisch bildet 3,8% (15.900 Personen) bei insgesamt 5,6% auf die Grundgesamtheit. Fast 1% machen die Familien mit der Kombination „Italienisch-andere Sprache“ aus. Naturgemäß gibt es mehr Personen mit zwei Erstsprachen in den Gemeinden mit einem beträchtlichen Italieneranteil.
Aufschlussreich auch die Ergebnisse des Sprachbarometers auf die Frage, welcher Sprachgruppe sich die Südtiroler, die zwei Erstsprachen haben, zugehörig fühlen. Es hat den Anschein, dass sich diese Personen quantitativ so aufteilen, wie die Sprachgruppen insgesamt, etwa bei der offiziellen Zugehörigkeitserklärung. Nur 2.000 Personen (12,5% dieser Gruppe) fühlen sich keiner der drei Gruppen zugehörig.
Beim Thema Beherrschung der Zweitsprache ist es kein Novum, dass fast alle Deutschsprachigen in gewissem Maß Italienisch sprechen. Aber ganz positiv hervorzuheben ist: 2014 sprechen zwei von drei Italienern in Südtirol Deutsch. 10 Jahre früher (Sprachbarometer 2004) waren es erst 47,7% gewesen. Ein Kompliment der italienischen Sprachgruppe und auch ein Erfolg der Autonomie: es gibt nicht viele Minderheitenregionen, in welchen die Angehörigen des Staatsvolks die Minderheitensprache vor Ort in diesem Ausmaß lernen. Dass es beim Deutsch-Unterricht noch viel zu tun gibt, führt das ASTAT an anderer Stelle im Detail aus.
Etwas besorgniserregend dagegen die „Zweitsprachverteilung“ bei den Zuwanderern. Zwei von drei Ausländern leben zwar in den vom ASTAT so genannten zweisprachigen Gemeinden, aber insgesamt sprechen 62% der Ausländer – neben ihren Muttersprachen – Italienisch, nur 24,6% Deutsch. Für die Integrationschancen in einem eher deutschsprachigen Umfeld hat diese Einstellung zu den lokalen Sprachen schon eine Bedeutung.
Nun gibt es Publikationen, die schon von Südtirol als einer „zweisprachigen Region“ oder gar einem melting pot berichten. Hinsichtlich der Zwei- und Dreisprachigkeitsregeln im öffentlichen Bereich mag das schon gelten, in der konkreten Sprachbeherrschung muss man auf dem Teppich bleiben. Südtirol ist ein Land mit immer mehr Menschen, die die zweite Landessprache und weitere Sprachen immer besser beherrschen, wäre etwas realitätsnäher ausgedrückt. Und dies bestätigt der Sprachbarometer 2014. Immerhin ein Drittel der Südtiroler kann relativ gut Englisch verstehen und sprechen. Vergleichbar gute Kenntnisse in einer Drittsprache haben nur die Flamen (Französisch und Englisch) und die Niederländer (Deutsch und Englisch) sowie die Schweden. In diesem Sinn kommt Südtirol dem von der EU propagierten Spracherwerbsideal „Erstsprache+ zwei Fremdsprachen“ immer näher. Die Entwicklung ist aber nicht nur subjektiv und quantitativ zu erfassen, sondern in einer derartig beschriebenen Situation der Zweisprachigkeit tritt die Qualität der Sprachbeherrschung in den Vordergrund, und auch diese analysiert der ASTAT-Sprachbarometer ausführlich. Denn wenn 45,5% der Südtiroler angeben, sich auf Englisch verständigen zu können, sind wir deshalb noch lange nicht „dreisprachig“. Auch mehr als die Hälfte der Bundesbürger spricht Englisch, ohne dass die deutsche Bevölkerung als „zweisprachig“ definiert würde. Auch die vielgepriesene Mehrsprachigkeit der Ladiner ist mit Qualitätskriterien zu betrachten. Diese mögen nämlich die beiden anderen Landessprachen gut beherrschen, aber sehr viele, anscheinend die Mehrheit, können die eigene Muttersprache nicht schreiben.
Fazit: Beim Sprachenlernen sind wir an einem guten Punkt, aber von der „Mehrsprachigkeit“ noch ein gutes Stück entfernt.


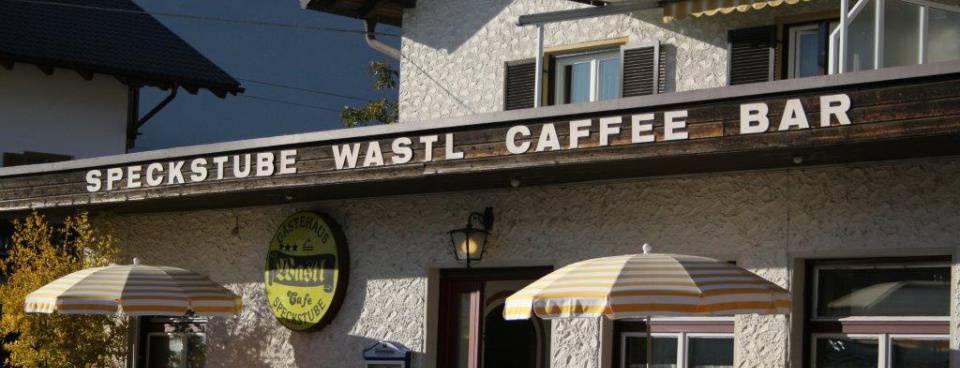
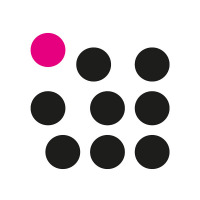
Kommentar schreiben
Zum Kommentieren bitte einloggen!Kommentare