Mit realistischem Blick und unprätentiöser Sprache analysiert Paul Tiefenbach in seinem 2013 bei VSA erschienen Buch beispielsweise, ob Volksentscheide in den USA von finanzstarken Gruppen beliebig gesteuert werden können. Direkte Demokratie wie in Kalifornien: ein Spielball des power of money? Dann befasst er sich mit dem für Deutschland und Italien typischen „Finanztabu“ bei Volksentscheiden. Sollen Bürger auch per Volksentscheid Steuern senken, Kredite aufnehmen, Ausgaben beschließen können? Wer ist für die übermäßige öffentliche Verschuldung verantwortlich?
Ein zentraler Einwand gegen direkte Demokratie unterstellt, dass die Mehrheitsentscheide systematisch Minderheitenrechte gefährden würden. Von den Schweizer Minarett- und Ausschaffungsinitiativen wird abgeleitet, dass das Volk grundsätzlich gegen Minderheiten wie Schwule, Ausländer, Muslime stimmen würde. Tiefenbachs Argumentation ist differenziert und gut dokumentiert. Er verschweigt nicht Bereiche, wo die rein parlamentarische Demokratie ausnahmsweise überlegen ist.
Wird mit direkter Demokratie die Todesstrafe wieder eingeführt? Soll das Volk immer ein Veto einlegen können? Überspitzt: sollen die Passagiere darüber abstimmen, ob ihr Flugzeug notlanden soll? Immer wieder geht es in der Diskussion um diese Frage: Ist „das Volk“ überhaupt kompetent genug, über dies und das abzustimmen, wobei Politiker und Journalisten meistens sich selbst für alles kompetent halten. Man könne doch über wichtige Fragen nicht uninformierte Bürger abstimmen lassen. Das gleiche Argument, so Tiefenbach, wurde schon gegen das Wahlrecht, später gegen das Frauenwahlrecht vorgebracht. Und doch schwingt es immer wieder mit, gerade jetzt beim Bürgerentscheid in Mals wird von den Gegnern unterstellt, die Bevölkerung könne gar nicht beurteilen, welche Pestizide ihr gut oder weniger gut tun.
Wird durch direkte Demokratie der Populismus befördert, sind Volksentscheide anfälliger für Demagogie als Wahlen?
Es ist Tiefenbach hoch anzurechnen, dass er sich mit solchen Einwänden auseinandersetzt, die nicht nur in Italien immer wieder von solchen Politikern ins Feld geführt werden, die Demagogie schon immer als probates Mittel betrachtet haben. Umso mehr betont der Autor die Bedeutung der breiten, öffentlichen Debatten, die echten Volksentscheiden vorausgehen muss. Tiefenbach erklärt aber auch, auf welche Weise Volksentscheide Politik- und Parteienverdrossenheit mindern können, wie sie die politische Tagesordnung mit neuen Vorschlägen und Ideen bereichern. Erfahrungen aus Ländern, in denen seit mehr als hundert Jahren regelmäßig Volksentscheide stattfinden, veranschaulichen die Argumentation. Der Autor lässt Probleme, Risiken und frustrierende Seiten der direkten Demokratie nicht unter den Tisch fallen - das macht den Band für Skeptiker wie für Befürworter lesenswert. Eine Übersetzung ins Italienische wäre wünschenswert.
Paul Tiefenbach, Alle Macht dem Volke? Warum Argumente gegen Volksentscheide meistens falsch sind, VSA Verlag, 2014, ISBN 978-3-89965-560-5



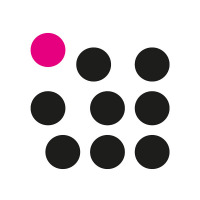

Aggiungi un commento
Effettua il login per aggiungere un commento!Commenti